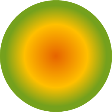Nach der Nutzung privater PV-Anlagen auf Eigenheimen, können mit dem Mieterstrommodell auch Mieter und Vermieter von Mehrfamilienhäusern durch die Produktion von sauberen PV-Strom an der Energiewende profitieren. Wie bei Strom von Dächern von Eigenheimen, liefert der Betreiber der Anlage dafür den selbsterzeugten Strom hinter dem Netz an die Bewohner des Hauses und erhält dafür neben dem Verkaufspreis eine Mieterstromprämie, die im EEG geregelt ist. Überschüssiger Strom kann zudem für die Überschussvergütung in das öffentliche Netz eingespeist werden. Energiegenossenschaften müssen sich im Klaren sein, dass sie in diesem Modell zum Energieversorger werden und somit auch für die Versorgung mit Reststrom verantwortlich sind. Hierfür bietet sich eine Kooperation mit einem Ökostromanbieter.
Letzte Aktualisierung am September 14, 2022